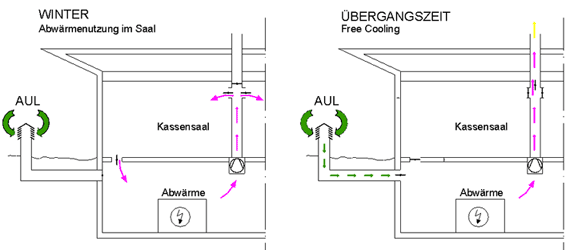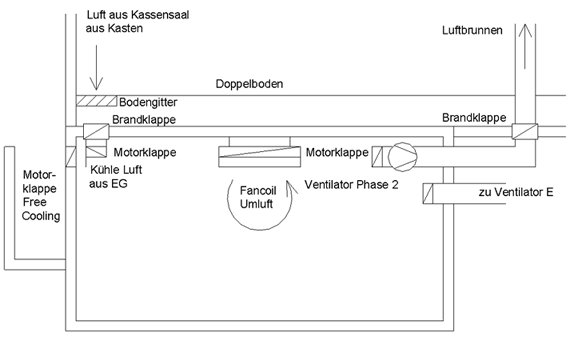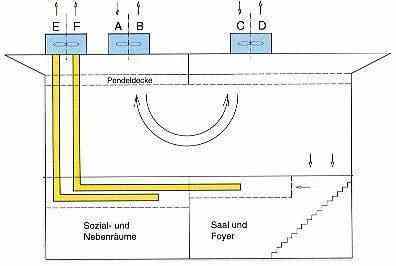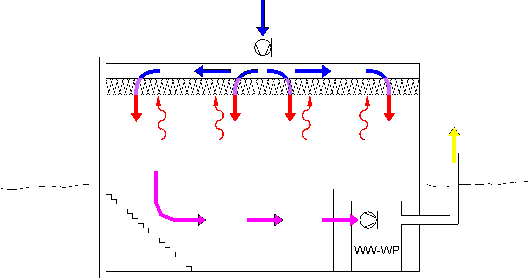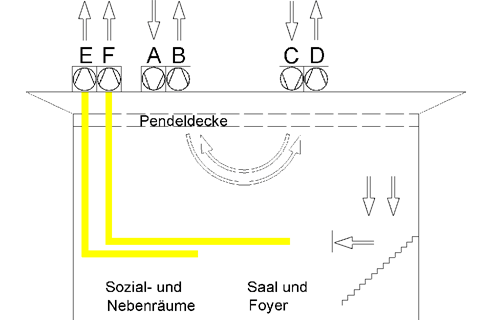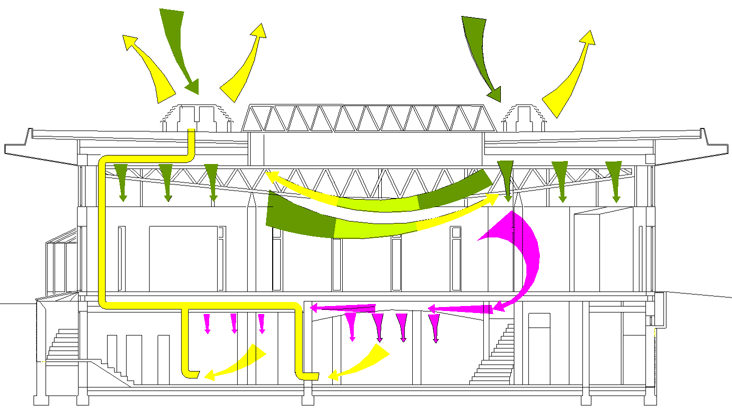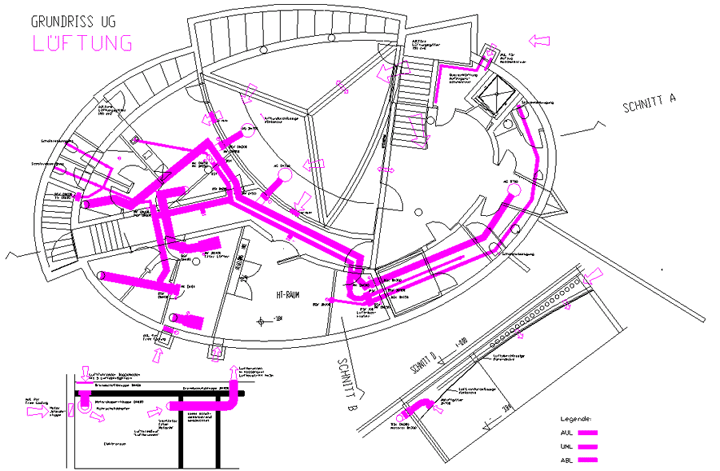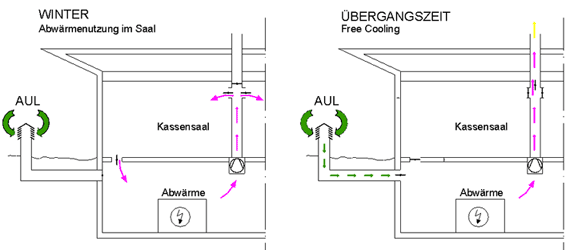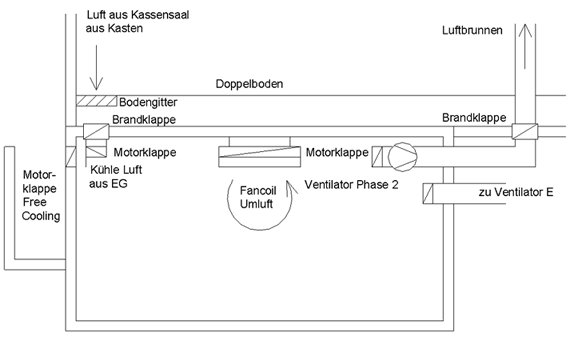Bank Austria Hirschstetten
Lüftung
Ein Gebäude verliert im Winter Wärme durch Lüftung aber auch durch die Wände. Ziel bei der Planung des Lüftungssystems war es, einerseits den Transmissionswärmebedarf als auch den Lüftungswännebedarf zu senken.
Der Transmissionswärmeverlust entsteht dadurch, daß die Wärme sozusagen durch die Wand von innen nach außen fließt. Im Bereich der Dachfläche ist dies besonders gravierend, da sie einerseits im Verhältnis zu den übrigen Außenflächen sehr groß ist, und andererseits die Wärme bekanntlich aufsteigt.
Die gesamte Dachkonstruktion wurde daher als eine Art Gegenstromwärmetauscher ausgebildet, das heißt, daß die gesamte Dach- und Deckenkonstruktion über dem EG porös ist und eine Luftströmung von außen nach innen oder umgekehrt erlaubt.
Dies hat folgende Konsequenz: Wenn im Winter die Wärme von innen nach außen durch die Deckenkonstruktion fließt und gezielt dazu im Gegenstrom die kalte Außenluft durch diese Decke eingesaugt wird, so kann die Frischluft sich dabei erwärmen und verhindert damit den Wärmeverlust über diese Decke.
Die Lüftung der Haupträume des Gebäudes erfolgt über eine Porendecke (Quelluftdecke) mit folgendem Aufbau (von oben nach unten im Bereich unter den Dachventilatoren):
- Dachventilator
- Luftraum (zwischen 68em hohen Holzleimbindern)
- Schafwolldämmatte 15 cm
- Holzwolle-Leichtbauplatten 5 cm
- Hohllochziegel 22 cm
- Luftraum
- Abgehängte Gipsfaserplatten, 12,5 mm, mit eingebetteten Heiz-/ Kühlschlangen, dazwischen Lochung, Ø 22 mm.
Lüftungsfunktionsweise
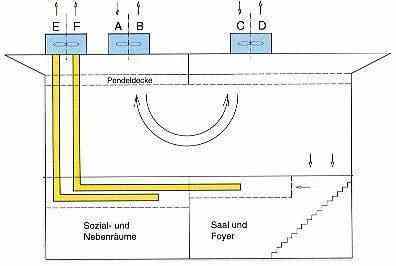 |
Die gesamte Decke über dem EG ist strömungs- und heizungstechnisch in zwei gleich große Bereiche geteilt. Werden z. B. die Ventilatoren A und D eingeschaltet, so wird die Außenluft durch die Decke in Hälfte AB gesaugt und dort wie bei der konventionellen Porendecke konditioniert. Die Luft vermischt sich durch Konvektion im Kassenraum und wird im Bereich CD abgesaugt.
Im Bereich CD strömt die warme Luft von unten nach oben durch die Ziegel, wärmt diese dabei auf und gibt auch Wasserdampf ab. Wird nach einer Weile die Förderrichtung durch Umschalten der Ventilatoren umgekehrt, so strömt nun im Bereich CD die kalte Außenluft durch die vorgewärmten und angefeuchteten Ziegel und nimmt die darin gespeicherte Wärme und Feuchtigkeit auf Ein Teil der Fortluftwärme kann dadurch rückgewonnen werden, die Rückgewinnungsrate liegt laut Berechnung bei ca. 50 %.
|
Die Luftgeschwindigkeit liegt bei diesem System zwischen 0,4 und 1,0 cm/sec, d. h. sehr viel geringer als die Grenze der Fühlbarkeit einer Luftbewegung (20 cm/sec).
Die Luftversorgung des Untergeschosses erfolgt aus dem Luftraum des Kassensaales und zwar so, daß die Luft über die offene Stiege in das Untergeschoß gelangt und über Gitter in die abgehängte Decke der UG-Räume einströmt. Die gesamte abgehängte Decke im Untergeschoß ist als zusammenhängender Luftraum ausgebildet, so daß die bei der Stiege in die abgehängte Decke des UG einströmende Luft Zutritt zu allen übrigen Räumen im UG hat. Aus den jeweiligen Räumen wird die Luft dann nach Bedarf abgesaugt und über Dach ausgeblasen.
Die im Normalfall benötigten geringen Volumina für Sozialraum, Garderobe, WC usw. werden bedarfsgerecht abgesaugt und ausgeblasen, ohne daß die Pendeldecke dadurch gestört wird. Wird der Saal benutzt, so schalten sich die Ventilatoren für das Schaukelprinzip der Pendelluftdecke im EG ab und die Luft wird über beide Deckenhälften der EG-Decke eingesaugt. Der Wärmeverlust bei dieser Betriebsweise ist aufgrund der voraussichtlich seltenen Benutzung des Saales wirtschaftlich unerheblich.
Die Absaugung aus dem Untergeschoß erfolgt dabei über zwei Ventilatoren. Der Mehrzwecksaal und das Foyer mit einer Luftleistung von bis zu 2400 m3/h (bei voller Belegung) werden über den Ventilator F abgesaugt.
Im Standardfall, d. h. ohne Saalbetrieb, läuft nur der Ventilator E mit bis zu 600 m3/h und saugt die Luft aus dem Sozialraum und den Nebenräumen ab. Diese Abluft wird durch ein eigenes Abluftrohr über Dach geleitet.
Einen gänzlich getrennten und zusätzlichen Luftkreis weist der Elektroraum im UG auf Die dort laufend anfallende Abwärme bis zu 3 kW muß abgeführt werden. Dies geschieht auf drei Arten:
- Luftbrunnen zum Kassensaal
- Free Cooling-Betrieb
- Fancoilgerät
Bei der Luftbrunnenbetriebsweise strömt aus dem Kassensaal Luft über einen Kanal in den Elektroraum, nimmt dort die Abwärme auf und wird wieder in den Kassensaal geleitet. Beim Free Cooling-Betrieb saugt der Ventilator die zu warme Luft aus dem Elektroraum im UG ab und über eine Jalousieklappe strömt kühle Außenluft vom Traufenpflasterbereich in den Raum nach.
Lüftungskonzept
Ein Gebäude verliert im Winter Wärme durch Transmission und Lüftung.
Ziel bei der Planung des Lüftungssystems war es, den Transmissionswärmebedarf
und den Lüftungswärmebedarf gemeinsam zu senken. Der Transmissionswärmeverlust
entsteht dadurch, dass die Wärme durch die Wand von innen nach außen
fließt. Im Bereich der Dachfläche ist dies besonders gravierend,
da sie einerseits im Verhältnis zu den übrigen Außenflächen
sehr groß ist, und andererseits die Wärme bekanntlich aufsteigt.
Die gesamte Dachkonstruktion wurde daher als eine Art Gegenstromwärmetauscher
ausgebildet, dergestalt, dass die Dach- und Deckenkonstruktion über dem
EG pöros ist und eine Luftströmung von außen nach innen oder
umgekehrt erlaubt. Dies hat folgende Konsequenz: Wenn im Winter die Wärme
von innen nach außen durch die Deckenkonstruktion fließt und gezielt
dazu im Gegenstrom die kalte Außenluft durch diese Decke eingesaugt wird,
so kann sich die Frischluft dabei erwärmen und verhindert damit den Wärmeverlust
über diese Decke. Durch geeignete Wahl von Dämmstoffdichte und Porosität,
Luftmenge und Strömungsgeschwindigkeit wird eine Nullenergiedecke erzielt.
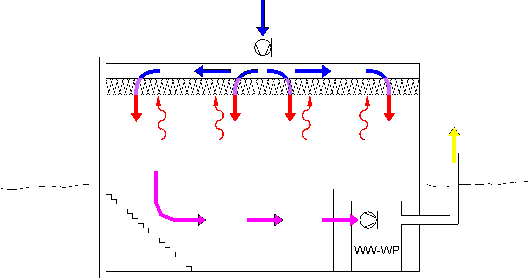
Die Lüftung des Kassensaals erfolgt über eine Porendecke (Quellluftdecke)
mit folgendem Aufbau (von oben nach unten im Bereich unter den Dachventilatoren):
- Dachventilator
- Luftraum (zwischen 68 cm hohen Holzleimbindern)
- Schafwolldämmung 15 cm
- Holzwolle-Leichbauplatten 5cm
- Hohllochziegel 22 cm
- Luftraum
- Abgehängte Gipsfaserplatten, 12,5 mm, mit eingebetteten Heiz-/ Kühlschlangen, dazwischen Lochung, Æ
22 mm.
Die gesamte Decke über dem EG ist strömungs- und heizungstechnisch
in zwei gleich große Bereiche geteilt. Werden z.B. die Ventilatoren A
und D eingeschaltet, so wird die Außenluft durch die linke Deckenhälfte
gesaugt und dort wie bei der konventionellen Porendecke konditioniert. Die Luft
vermischt sich durch Konvektion im Kassenraum und wird im rechten Bereich abgesaugt.
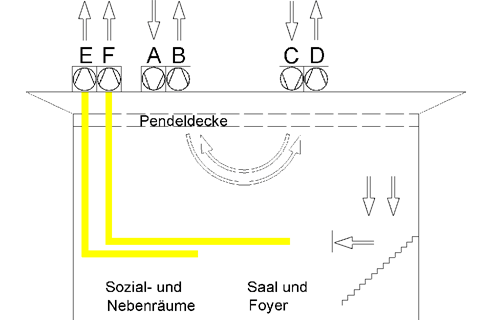
In der rechten Deckenhälfte strömt die warme Luft von unten nach oben
durch die Ziegel, wärmt diese dabei auf und gibt auch Wasserdampf ab. Wird
nach einer Weile die Förderrichtung durch Umschalten der Ventilatoren reversiert,
so strömt nun in der rechten Deckenhälfte die kalte Außenluft
durch die vorgewärmten und angefeuchteten Ziegel und nimmt die darin gespeicherte
Wärme und Feuchtigkeit auf. Ein großer Teil der Fortluftwärme
kann dadurch rückgewonnen werden, die Rückgewinnungsrate liegt über
70%. Die Luftgeschwindigkeit liegt bei diesem System zwischen 0,4 und 1,0 cm/sec,
d.h. sehr viel geringer als die Grenze der Fühlbarkeit einer Luftbewegung
(20cm/sec). Stetige aber unauffällige Frischluftzufuhr sorgt für ein
angenehmes Raumklima.
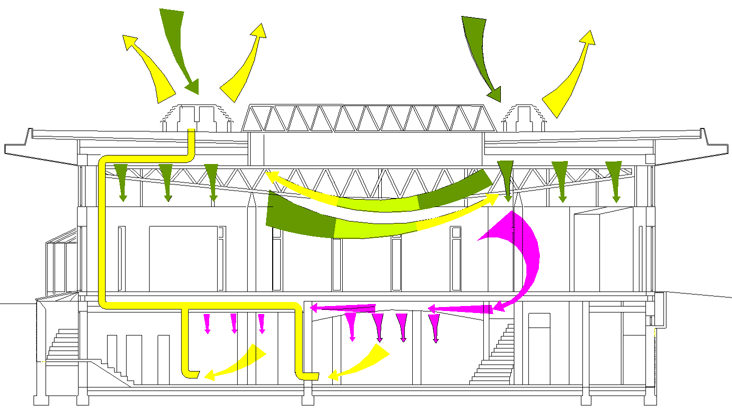
Die Luftversorgung des Untergeschosses erfolgt aus dem Luftraum des Kassensaales
und zwar so, dass die Luft über die offene Stiege in das Untergeschoß
gelangt und über Gitter in die abgehängte Decke der UG-Räume
einströmt. Die gesamte abgehängte Decke im UG ist als zusammenhängender
Luftraum ausgebildet, so dass die bei der Stiege in die abgehängte Decke
einströmende Luft Zutritt zu allen übrigen Räumen im UG hat.
Aus den jeweiligen Räumen wird die Luft dann nach Bedarf abgesaugt und
mit den Ventilatoren E und F über Dach ausgeblasen.
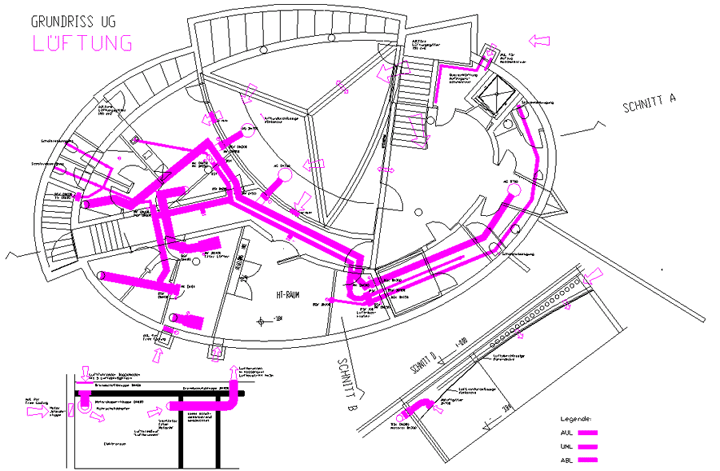
Die im Normalfall benötigten geringen Volumina für Sozialraum, Garderobe,
WC usw. werden bedarfsgerecht abgesaugt und ausgeblasen, ohne dass die Pendeldecke
dadurch gestört wird. Wird der Saal benutzt, so schalten sich die Ventilatoren
A bis D für das Schaukelprinzip der Pendelluftdecke im EG ab und die Luft
wird über beide Deckenhälfte der EG-Decke eingesaugt. Der Wärmeverlust
bei dieser Betriebsweise ist aufgrund der seltenen Benutzung des Saales wirtschaftlich
unerheblich.
Die Absaugung aus dem UG erfolgt dabei über zwei Ventilatoren. Der Mehrzwecksaal
und das Foyer mit einer Luftleistung von bis zu 2400m³/h (bei voller Belegung)
werden über den Ventilator F abgesaugt.
Im Standardfall, d.h. ohne Saalbetrieb, läuft nur der Ventilator E mit
bis zu 600m³/h und saugt die Luft aus dem Sozialraum und den Nebenräumen
ab. Diese Abluft wird durch ein eigenes Abluftrohr über Dach geleitet.
Einen gänzlich getrennten und zusätzlichen Luftkreis weist der Elektroraum
im UG auf. Die dort laufend anfallende Abwärme bis zu 3kW muß abgeführt
werden. Dies geschieht auf drei Arten:
- Luftbrunnen zum Kassensaal
- Free Cooling Betrieb
- Fancoilgerät
Bei der Luftbrunnenbetriebsweise strömt aus dem Kassensaal Luft über
einen Kanal in den Elektroraum, nimmt dort die Abwärme auf und wird wieder
in den Kassensaal geleitet. Beim Free Cooling Betrieb saugt der Ventilator die
zu warme Luft aus dem Elektroraum im UG ab und über eine Jalousieklappe
strömt kühle Außenluft vom Traufenpflasterbereich in den Raum
nach.